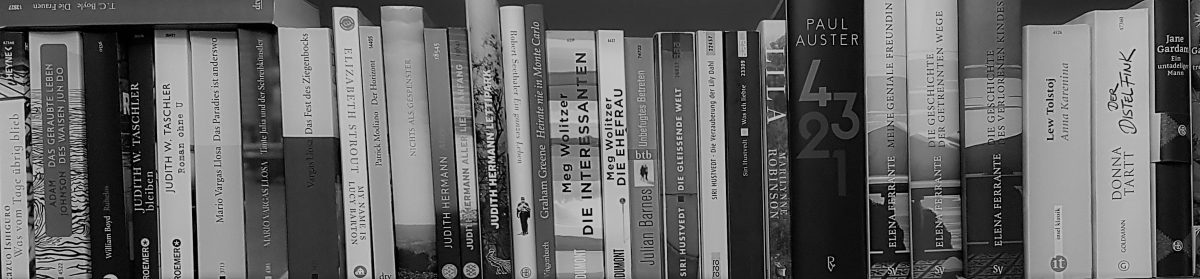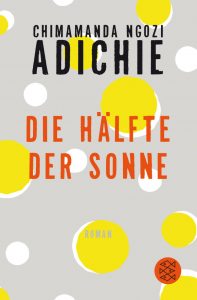
In Adichies Roman Die Hälfte der Sonne geht es um die Gründung des von Nigeria unabhängigen Staates Biafra 1967 sowie um den darauf folgenden Biafra-Krieg.
Trotz des Fokus auf dem politischen Geschehen im Nigeria der Sechzigerjahre entsteht in Adichies Roman nicht das Gefühl, man lese ein Geschichtsbuch, eine politische Abhandlung oder gar einen Kriegsbericht. Erzählt wird vielmehr eine sehr persönliche, mitreißende Geschichte, deren (teilweise politisch sehr aktive) Hauptpersonen alle auf die eine oder andere Weise vom Biafra-Krieg betroffen sind.
Adichies Roman wird abwechselnd aus der Sicht der drei Protagonisten Olanna, Ugwu und Richard wiedergegeben.
Olanna, Tochter aus reichem Haus, lässt ihr privilegiertes Leben in Lagos hinter sich. Sie zieht in die Provinz zu ihrem Lebensgefährten Odenigbo, einem links-intellektuellen Mathematikprofessor, und nimmt eine Stelle als Soziologie-Dozentin an. Olanna und Odenigbo, beide Angehörige der Igbo, einem der drei großen Stämme Nigerias, setzen sich für ein freies, selbstbewusstes Afrika und somit gegen die bestehende Militärregierung ein. Zusammen mit ihrem Freundeskreis stehen sie für eine moderne nigerianische Mittelschicht, die ihren Weg zwischen afrikanischer Tradition einerseits und Aufklärung und technischem Fortschritt andererseits sucht. Mit Olanna schafft Adichie nicht nur ein Bindeglied zwischen Tradition und Moderne, sondern auch zwischen den verschiedenen sozialen Schichten und Lebensweisen. Sie entstammt der reichen Oberschicht, verlegt ihren Lebensmittelpunkt bewusst in die intellektuelle Mittelschicht, zeigt aber auch immer wieder Nähe und Sympathie für die ländliche Bevölkerung.
Ugwu, Vertreter dieser traditionellen, ländlichen afrikanischen Bevölkerung, kommt als Houseboy zu Odenigbo, der ihn zur Schule schickt und ihm die Welt der Bücher nahe bringt. Durch Ugwus Erinnerungen an sein Dorf und seine Familie, sein Leben und seine Besuche dort beschreibt Adichie das einfache, traditionelle Dorfleben in Westafrika. Gleichzeitig wird mit der äußerst liebenswerten Figur des Ugwu und der Darstellung seiner anfänglichen Verwunderung über das Leben bei Odenigbo und Olanna gezeigt, wie fremd, schockierend und teilweise erschreckend für die afrikanische Bevölkerung die Konfrontation mit der europäischen Zivilisation sein muss. Für Ugwu ist es anfangs jenseits jeglicher Vorstellung, in einem Haus aus Zement mit Kühlschrank und Wasserhahn zu wohnen und darüber hinaus auch noch die Möglichkeit zu haben, jeden Tag Fleisch essen zu können. Selbst nach einiger Zeit im Hause Odenigbos und Olanna mit all ihren Büchern und Gesprächen ist es für ihn selbstverständlich, dass das Töten eines Geckos Magenschmerzen verursacht, und Odenigbos Mutter von Hexen spricht und mit Zaubertränken hantiert.
Adichie beschreibt auf herzerwärmende Art und Weise, wie sich Odenigbo, Olanna und Ugwu trotz einiger Tiefschläge ihr eigenes kleines Idyll kreieren und quasi als Familie zusammenwachsen. Als kleine Zugabe unternimmt sie dabei immer wieder wunderbare kurze Exkurse in die traditionelle westafrikanische Küche mit Yamswurzeln, Maniok, Kolanüssen, Pfeffersuppe, Moi Moi, Huhn in Bittermelone und Jollof-Reis, was dem Roman nicht nur eine gewisse Exotik verleiht, sondern einem beim Lesen auch das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt.
Richard, der dritte Charakter, aus dessen Sicht Teile des Romans erzählt werden, ist Schriftsteller und Journalist aus England. Er wird der Lebensgefährte von Kainene, Olannas Zwillingsschwester, die die Geschäfte der Eltern unterstützt und übernimmt. Richard verkörpert überhaupt nicht den machtbesessenen europäischen Kolonialisten, sondern ist ein zurückhaltender junger Mann, der sich in Afrika schriftstellerisch verwirklichen möchte. Durch Richard vermittelt Adichie einerseits eine Art Außensicht auf die nigerianische Gesellschaft, andererseits beschreibt sie durch ihn und seine Dialoge mit Kainene die reiche, korrupte Oberschicht, der Olannas und Kainenes Eltern angehören. So beschreibt Kainene z.B. ihre Erziehung in Richards Erzählung:
„Von hier aus kann man Heathgrove sehen“, sagte sie und zeigte in eine Richtung. „Die ungeheuer kostspielige und verschwiegene britische Oberschule, die meine Schwester und ich besucht haben. Mein Vater fand uns zu jung, um ins Ausland geschickt zu werden, war aber entschlossen, uns so weit zu Europäerinnen zu machen wie möglich.“ […] Die Schule ist so exklusiv, dass viele Nigerianer nicht einmal wissen, dass sie existiert.“
und straft die nigerianische Oberschicht folgendermaßen ab:
„Die neue nigerianische Oberklasse ist eine Ansammlung von Ungebildeten, die nichts lesen, in überteuerten libanesischen Restaurants Essen in sich hineinschaufeln, das ihnen nicht schmeckt, und deren Gespräche sich in einem Thema erschöpfen – wie macht sich das neue Auto?“
So unterschiedlich Olanna, Ugwu und Richard auch sind, verbindet sie doch alle der Wunsch nach einem eigenen, unabhängigen Staat Biafra und alle drei setzen sich dafür jeweils auf ihre Art ein.
Mit Beginn des grausigen Bürgerkriegs endet jedoch ihr friedliches und gewohntes Leben und alles wird anders. So wird Ugwu zum Militär eingezogen, Olanna erlebt ein Massaker zwischen zwei Stämmen hautnah mit und kommt dabei beinahe ums Leben, geliebte Personen werden vermisst und alle leiden unter dem grausamen Hunger.
Einige Rezensenten kritisieren, dass Adichies Roman kein wirklich politischer sei, da Familiengeschichten und persönliche Schicksale im Vordergrund stünden. Gerade dies zeichnet den Roman aus meiner Sicht jedoch aus. Historische Fakten und Politik werden nicht vollständig und im Detail referiert, sondern am Schicksal und Erleben der Hauptpersonen des Romans reflektiert. Dies bringt dem Leser die Geschehnisse auf eine zwar weniger faktenreiche, vollständige, dafür aber umso nachvollziehbarere und verstehbarere Form nahe. Trotz oder gerade wegen dieser persönlichen Schicksale entwickelt sich beim Lesen das Bedürfnis, sich näher mit dem politischen Thema auseinanderzusetzen und mehr über Nigeria, dessen Entstehung, die Hintergründe der Kolonialisierung sowie über den unabhängigen Staat Biafra – das Land mit der aufgehenden, der halben Sonne in der Flagge – zu erfahren.
Durch Adichies Erzählung kann man sich unter Biafra plötzlich viel mehr vorstellen als irgendein Land oder eine Region irgendwo in Afrika und kann die furchtbaren Bilder von abgemagerten, hungernden Menschen in einen Kontext setzen. Ohne die Historie der Kolonialisierung Nigerias durch die Briten zu beschreiben, wird deutlich, wie problematisch es ist, mehr als 200 verschiedene Völker mit teilweise eigenen Sprachen und Religionen zu einem künstlichen Staatsgebilde zusammenzufügen und zu regieren. Die schizophrene Handlungsweise der Europäer, die einerseits Waffen liefern und andererseits Hilfsgüter verteilen, wird in wenigen Szenen dargestellt und bedarf keiner weiteren Erklärung. Durch ihren Roman schafft Adichie ein grobes Verständnis über die unterschiedlichen Interessenslagen im Biafra-Krieg, die Motivation der Igbo, sowie das letztendliche Scheitern der Unabhängigkeit.
Adichies Erzählweise ist unprätentiös und schlicht und gleichzeitig unfassbar fesselnd. Sie nimmt einen mit in die exotische und traditionelle Welt Afrikas, beschreibt diese aber so lebensnah, verbindet und konterkariert sie laufend mit der europäischen Kultur und dem modernen Afrika, so dass der Leser nicht zum außenstehenden Beobachter wird, sondern sich vollkommen vom Geschehen mitreißen lassen kann. Indem sie immer wieder Innensichten und Gefühlsbeschreibungen ihrer Figuren sowie unzählige kurze Dialogpassagen in ihre Erzählung einbaut, schafft Adichie eine große Lebensnähe und dadurch durchaus Identifikationspotential mit ihren Hauptfiguren. Am Ende bleibt der Wunsch und die Hoffnung, dass irgendwann die zweite Hälfte der Sonne am nigerianischen Himmel aufgeht…
Nach Blauer Hibiskus ist auch Adichies zweiter Roman schlicht brillant und unbedingt empfehlens- und lesenswert!
Adichie, Chimamanda Ngozi (2016). Die Hälfte der Sonne. Fischer: Frankfurt am Main.