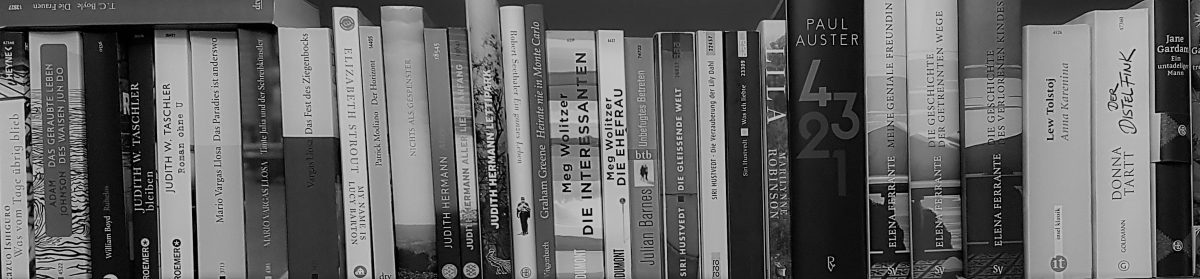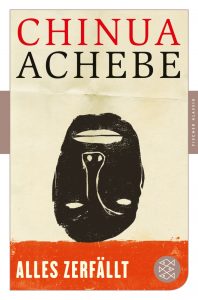
Alles zerfällt ist der erste Band der Afrikanischen Trilogie von Chinua Achebe. In diesem ersten Roman der Trilogie beschreibt er, wie die Kolonialisierung durch die Briten das afrikanische, vorkoloniale, ursprüngliche Stammesleben der Igbo im späteren Nigeria innerhalb kurzer Zeit zerfallen lässt.
Achebe gliedert seinen Roman in drei Teile, wobei der erste Teil, in dem er ein farbenfrohes, detailgetreues Porträt des traditionellen gesellschaftlichen Lebens am Niger Ende des 19. Jahrhunderts zeichnet, den weitaus größten Teil einnimmt.
Die Hauptfigur des Romans ist Okonkwo, ein selbstbewusstes und ehrgeiziges Stammesmitglied, der Schwäche verachtet und durch Stärke, Siege, Besitz und eine große Familie Macht und Ansehen erlangen will.
Okonkwo möchte sich von seinem Vater, den er für faul und schwach hält und für den er sich schämt, durch besonders großen Mut und Fleiß distanzieren und somit jegliche Schwäche und Unsicherheit von sich weisen. Das gesellschaftliche Gefüge des Stammes lässt dies auch zu; so schreibt Achebe
Zum Glück beurteilen dortzulande die Leute einen Mann nach seinem eigenen Wert, nicht nach dem seines Vaters. […] Obwohl Okonkwo jung war, zählt er bereits zu den Großen seiner Zeit. Sein Volk achtete die Alten, doch Hochachtung brachten sie verdienten Männern entgegen.
Okwonko hat ein sehr klares Weltbild, das Kriegertum, Stärke, Erfolg und Männlichkeit für gut befindet, Muse und Weichheit für weibisch, schwach und verachtenswert. Dabei ist Okonkwo keineswegs nur durch Stärke geprägt; auch er ist unsicher und hat weiche Gefühle, beides verbirgt er aber vehement sowohl vor sich als auch vor anderen.
Ziemlich am Anfang seines Romans charakterisiert Achebe seine Hauptfigur folgendermaßen:
Okonkwo führte sein Haus mit starker Hand. Seine Frauen, besonders die jüngste, lebten in ständiger Angst vor seiner aufbrausenden Natur, und nicht anders war es bei seinen kleinen Kindern.
Wahrscheinlich war Oknokwo im Innersten kein harter Mann. Doch beherrschte Angst sein ganzes Leben, Angst vor Misserfolg und Schwäche.
Etwas später schreibt er:
Okonkwo zeigte seine Gefühle nie offen, es sei denn die des Zorns. Zuneigung zu zeigen war ein Zeichen von Schwäche; das Einzige, was sich zu zeigen lohnte, war Stärke.
Anhand des Lebens von Okonkwo und dessen Familie beschreibt Achebe ganz unprätentiös und authentisch Alltagsszenen, diverse Höhepunkte des gesellschaftlichen Lebens sowie die verschiedenen Etappen eines Jahres, gegliedert durch Regen- und Trockenzeiten, denen der Zyklus des Yams, die Saat- und Erntezeit folgt. Er erzählt von der Woche des Friedens, den Beschäftigungen während der Regenzeit, dem Fest des neuen Yams, von Brautpreisverhandlungen, Gerichtsverfahren und Beerdigungen. Dabei lässt er auch kritische Themen wie Menschenopfer, das systematische Aussetzen und somit das indirekte Töten von Zwillingen, die hohe Kindersterblichkeit, das Verprügeln und die Unterdrückung von Frauen sowie die Ausgrenzung von vermeintlich Aussätzigen nicht aus.
Achebe spickt seine Erzählung mit Beschreibungen der afrikanischen Küche, diversen Igbo-Sprichwörtern sowie Geschichten und Anekdoten, die den tief verwurzelten Glauben in Westafrika darstellen, was seine Beschreibung des Dorf- und Stammesleben umso authentischer und plastischer erscheinen lassen. So bereiten die Frauen Fufu, Yams- und Egusi-Eintopf, Bitterspinatsuppe und Maniok zu, zu wichtigen Anlässen wird Palmwein gezapft und getrunken und unter Männern reicht, bricht und kaut man die Kolanuss und Mbongo-Pfeffer. Es gibt machtvolle Kriegszauber, man folgt dem Orakel, huldigt und besänftigt die Götter mit Opfergaben, es gibt heilige Kapokbäume, rituelle Feste und Tänze, gut funktionierende dörfliche Gemeinschaften und Freundschaften, Geschichten vom Schildkrötenmann, vom Streit zwischen Himmel und Erde und viele mehr.
Am Ende des ersten Teils ist Okonkwo in einen unglücklichen Unfall verwickelt, weshalb er seinen Klan für sieben Jahre verlassen muss, die er mit seiner Familie im Klan seiner Mutter verbringen wird.
Die Zeit seiner Verbannung ist Inhalt des zweiten Teils des Romans. Neben seiner anfänglichen Verzweiflung im Exil geht es in diesem Teil erstmals um die Ankunft des weißen Mannes sowie die Ausrottung eines benachbarten Dorfes durch die Weißen. Bis zu diesem Zeitpunkt war der weiße Mann nur vom Hörensagen bekannt, doch nun wird die Bedrohung durch ihn zum ersten Mal real. Dies beschreibt Obierika, ein Freund Okonkwos folgendermaßen:
„Doch mir macht die Sache große Angst. Wir alle kennen die Geschichten von den weißen Männern, die mächtige Feuerwaffen schufen und starke Getränke brauten und Sklaven über die Wasser brachten, aber niemand hielt die Geschichten für wahr.“
Mit den Weißen kommen auch die Missionare in Okonkwos Heimatdorf; allerdings glauben die Mitglieder des Klans nicht an nachhaltige, einschneidende Veränderungen oder Gefahr für ihre Kultur. Denn
Nicht einer der Bekehrten war ein Mann, dessen Wort in der Dorfversammlung Gewicht hatte Nicht einer war ein Titelträger. […] Chielo, die Priesterin Agbalas, nannte die Bekehrten Kot des Klans, nun den neuen Glauben einen wilden Hund, der kam, ihn zu fressen.
Okonkwos Reaktion auf die Darlegung der Heiligen Dreifaltigkeit durch die Missionare beschreibt Achebe folgendermaßen:
Am Ende war Okonkwo restlos überzeugt, dass der Mann verrückt war. Er zuckte mit den Achseln und ging seinen Nachmittagswein zapfen.
Was Okonkwo und die „starken“ Mitglieder des Klans jedoch unterschätzen, sind die vermeintlich schwächeren Klan-Mitglieder (unter ihnen auch Okonkwos ältester Sohn), die mit bestimmten Vorkommnissen und Traditionen wie zum Beispiel den Menschenopfer oder ausgesetzten Zwillings-Babys nicht gut zurechtkommen. Außerdem bringt der weiße Mann nicht nur Missionare in die Dörfer, sondern etabliert neben Kirchen auch eine Regierung und Gerichte.
Der dritte und mit Abstand kürzeste Teil des Romans beschreibt Okonkwos Rückkehr in sein Dorf und seinen Untergang.
Er beginnt mit Okonkwos Plänen, wie er sich in seinem Dorf wieder etablieren und seine gute Stellung zurückgewinnen will, schnell wird aber klar, dass sich das Leben in den sieben Jahren seiner Abwesenheit komplett geändert hat und nichts mehr ist, wie es war. Die Weißen sind erstarkt, selbst einige angesehene Klan-Mitglieder sind zu dem neuen Glauben übergelaufen, und es gibt einen „District Commissioner“, der diejenigen verurteilt und ins Gefängnis wirft, die gegen die Gesetze der Weißen verstoßen. Neben der Entwürdigung, die den Klan-Mitgliedern, die nicht mit dem neuen Glauben sympathisieren, wiederfährt, wird ihnen plötzlich klar, dass es keinen Ausweg, bzw. keinen Weg zurück gibt. Auch dies fasst Obierika, Okonkwos Freund, in Worte:
„Unsere eigenen Männer und Söhne laufen zu den Fremden über. Sie wenden sich ihrem Glauben zu, und sie helfen, ihre Regierung aufrechtzuerhalten. Wollten wir die weißen Männer aus Umuofia vertreiben, hätten wir leichtes Spiel. Es sind nur zwei. Aber was ist mit unseren eigenen Leuten, die es ihnen gleichtun und denen sie Macht verliehen haben? Sie würden nach Umuru laufen, um Soldaten zu holen, und es würde uns ergehen wie Abame.“
Die letzte Seite des Romans beschreibt Achebe aus Sicht des „District Commissioners“, der sich abmühte, diversen Teilen Afrikas die Zivilisation zu bringen und der plant, ein Buch mit dem Titel Die Befriedung der Eingeborenenstämme am Unteren Niger zu schreiben. Damit begründet Achebe quasi sein eigenes Buch, das die einseitige Sichtweise der Weißen, die Außensicht auf die afrikanische Gesellschaft, im Extremfall die Darstellung von kulturlosen Wilden konterkariert. Achebe idealisiert die Igbo-Kultur und -Lebensweise in seinem Roman nicht, er beschreibt sie jedoch liebenswert und detailgetreu und scheut sich nicht, sie auch mit all ihren Brüchen und Schwachstellen darzustellen. Er zeigt, wie einige darin (wie in jeder Gesellschaft) besser zurechtkommen, während andere straucheln und mit bestimmten Traditionen hadern. Er beschreibt sie als komplexes Gefüge intelligenter, ehrgeiziger, solidarischer Menschen, die Traditionen, Kultur und Menschlichkeit über Jahrhunderte gepflegt haben und verleiht somit der ursprünglichen Igbo-Kultur ein Gesicht und eine Stimme.
In den letzten beiden Teilen seines Romans zeigt er exemplarisch die Mechanismen auf, durch die es den Kolonialherren so schnell gelang, die Traditionen des Klans und das ursprüngliche Stammesleben so nachhaltig zu zerstören. Der Titel Alles zerfällt fasst das Empfinden der Hauptfigur während dieser letzten beiden Teile sehr treffend zusammen. Alles, was Okonkwo wichtig war sowie sein komplettes Weltbild zerfallen unaufhaltsam und in kürzester Zeit und es gelingt ihm nicht, sich an den Wandel anzupassen.
Achebes Portrait der Igbo-Kultur und seine Beschreibung des Zerfalls derselben sowie der einschneidende kulturelle Wandel für die Igbo durch die Kolonialisierung sind schlichtweg ganz große Klasse und sein Roman Alles zerfällt gilt nicht umsonst Klassiker der afrikanischen Gegenwartsliteratur, der für viele afrikanische Schriftsteller (so z.B. auch für Chimamanda Ngozi Adichie) wegweisend und prägend war und ist.
Achebe, Chinua (2014). Alles zerfällt. Fischer: Frankfurt am Main.